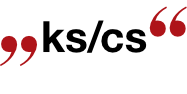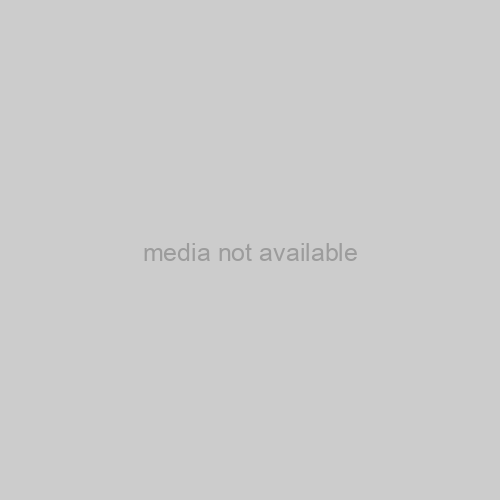Autor: Hendrik Fischer (publiziert in «Persönlich», März 2024, Anpassung der Redaktion am 30.04.2024)
Vor wenigen Wochen entschied sich das Berner Stadtparlament für ein Verbot kommerzieller Werbung im Aussenraum, sprich für ein Verbot von Werbung auf öffentlichem wie auch auf privatem Grund. Das äusserst knappe Resultat der Abstimmung mit 30 zu 29 Stimmen zeigte, dass die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der rot-grün dominierten Stadt Bern keine augenscheinliche Abneigung gegenüber der Werbung in den Strassen und Gassen der Bundesstadt haben. Vielmehr waren es persönliche Erfahrungen und eigene Grundsatzpositionen der Politikerinnen und Politiker, die den Entscheid ausmachten. Es wurden drei Argumente gegen ein Verbot wiederholt von allen politischen Seiten in die Debatte eingebracht: Die hohen finanziellen Einbussen eines Verbotes, die Einschränkung der Kommunikationsmöglichkeiten der Berner Kleinbetriebe, sowie die Unverhältnismässigkeit des Vorschlags.
Wer zahlt das entstehende Loch in den Kassen? Die Steuerzahlenden.
Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Wertschöpfung generiert die Aussenwerbung auch einen kräftigen Zustupf an finanziellen Mitteln für Gemeinden. Auf die Stadt Bern bezogen, erzeugt die Aussenwerbung jährliche Einnahmen von mehr als fünf Millionen Franken pro Jahr in Form von Konzessionsabgaben. In finanziell unbequemen Zeiten – in welcher sich manche Schweizer Stadt befindet – leistet die Aussenwerbung einen nicht zu ignorierenden Teil für den Finanzhaushalt. Zusätzlich finanziert sie auch die öffentlichen Verkehrsmittel in ähnlichem Mass. Diese sind auf die Einnahmen der Aussenwerbung angewiesen und wollen nicht auf die Mittel verzichten. Schweizweit betrachtet betragen die Abgaben aus Plakatwerbung an die öffentliche Hand mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr. Gerade im Hinblick auf die Netto-Null-Ziele vieler Städte benötigen wir aber dringend finanzstabile Städte und ein ÖV-Angebot, welches attraktiv ist und erneuert werden kann. Und das kostet verständlicherweise Geld, welches zu einem guten Teil von Werbung finanziert werden könnte und sollte.
Ähnliches spielt sich in der Stadt Zürich ab. Dort soll nämlich der Stadtrat unteranderem den digitalen Werbetafeln auf öffentlichem Grund den Stecker ziehen. Es müsse geprüft werden, wie die bereits installierten Werbescreens «zum frühestmöglichen Zeitpunkt» abgebaut und «ökologisch» entsorgt werden könnten. Doch wie ökologisch ist es dann schlussendlich, wenn erst gerade bewilligte und hergestellte Werbescreens bereits wieder entsorgt werden müssen, obwohl diese noch viele Jahre nutzbar wären? So fehlen schlussendlich der Stadt finanzielle Mittel, ohne das etwas zur Rettung des Klimas erreicht worden ist. Fallen diese Einnahmen weg, müsste das Defizit zum Beispiel mit Sparmassnahmen oder Steuergeldern beglichen werden. Ausserdem sind die digitalen Werbeplakate Teil des städtischen Lichtkonzepts. Würden die Bildschirme verboten, müssten diese überarbeitet und die Orte neu beleuchtet werden.
Städte, welche von Aussenwerbung «befreit» sind, gibt es faktisch nicht.
In den politischen Debatten werden oft zwei Beispielstädte zitiert, welche sich scheinbar erfolgreich für Werbeverbote im Aussenraum entschieden, und ein Verbot von Aussenwerbung umgesetzt hätten: Grenoble in Frankreich und São Paulo in Brasilien. Der erste Eindruck ist jedoch trügerisch. Denn Grenoble hat zwar die Anzahl an analogen Plakaten nach dem Entscheid reduziert, hat diese dann aber vermehrt mit digitalen Werbebildschirmen substituiert. Somit geht die Behauptung von der Berner Stadträtin Mirjam Rodel (GFL), dass es wunderschön sei, wenn das Alpenpanorama in Grenoble nicht durch Werbeplakate verschandelt werde, in der Realität nicht wirklich auf. Diese Flächen – laut dem Verband Aussenwerbung Schweiz sind es rund 1100 – sind nun einfach an Haltestellen des oder im öffentlichen Verkehr platziert. Die Stadt Bern, welche eine vergleichbare Einwohnerzahl aufweist, hat aktuell ebenfalls rund 1100 Flächen im Angebot. Man sieht also, dass mit einer durchdachten und abgestimmten Reglementierung des Werbeangebots, so wie es Bern hat, der vernünftige und richtige Weg eingeschlagen wurde.
Dass es klare gesetzliche Rahmenbedingungen benötigt, zeigt ein Beispiel aus Südamerika.
Denn die brasilianische Grossstadt São Paulo stand vor einer Herausforderung. Sie konnte die Menge an unbewilligten Plakaten auf privatem Grund nicht mehr kontrollieren und hat diese kurzum ganz verboten. Ein äusserst krasser Entscheid und Einschnitt in die Wirtschaftsfreiheit, welcher nicht nachzuahmen ist. Aber: Gleichzeitig zu diesem sehr einschneidenden Verbot von Aussenwerbung auf Privatgrund wurden tausende bewilligte digitale Flächen auf öffentlichem Boden geschaffen. So fliesst nun das Geld der Werbekonzessionen in die Kasse der Stadt.
Städte, welche Aussenwerbung einschränken wollten, haben schlussendlich gesehen, wie wertvoll diese Art von Werbung für sie sein kann, finanziell wie auch politisch. In der Schweiz stellen die Plakatfirmen zusammen mit den Städten schon lange mit restriktiven Reglementierungen sicher, dass ein Szenario wie in Brasilien nicht entsteht. So werden in Bern beispielsweise seit Jahren kaum neue Plakatstellen auf öffentlichem Grund bewilligt. Neben kommerziellen Anwendungsbereichen sind gleichzeitig auch die gesellschaftlichen Leistungen der Aussenwerbung wichtig und nicht zu vernachlässigen.
Neben Schweizer KMU’s profitieren auch Kultur und Politik vom Plakat
Linke Kreise bringen ihre bekannte Abneigung gegenüber Grosskonzernen oft in die Argumentation gegen Werbung ein. Dass diese finanziell gesehen grössere Werbekampagnen schalten als kleinere Akteure, ist verständlich. In einem freiheitlich organisierten Wirtschaftssystem ist das aber auch ihr klares Recht. Wenn aber die Anzahl an Unternehmen betrachtet wird, welche Plakatwerbung buchen, ist das Resultat plötzlich ganz anders. Da machen Schweizer KMUs nämlich 63% des Kundenstamms von Aussenwerbung aus. Für sie ist das Medium Plakat ein idealer Kanal, um kostengünstig und effizient ihre Kundinnen und Kunden zu erreichen. Wieso soll man dann der grossen Mehrheit diese Option verbieten?
Der kulturelle und politische Aspekt in der Aussenwerbung geht ebenfalls viel zu oft in der Diskussion verloren. Viele städtischen Werbereglemente halten nämlich fest, dass die Plakatfirmen kulturelle und politische Werbung oft kostenlos oder vergünstigt anbieten müssen. Kleben und platzieren also bei einem Verbot die Politikerinnen und Politiker ihre Wahlplakate selbst? Und wo, wenn es die Plakatstellen nicht mehr gibt?
Auch wenn die digitalen Werbekanäle vermehrt genutzt werden und sich als Alternativen anbieten, ist das Plakat trotzdem laut der Konsumentenstudie der WEMF AG für Werbemedienforschung weiterhin das beliebteste Werbemittel, welches nicht nur informativ ist, sondern von 70% der Schweizer Bevölkerung geschätzt wird. Zudem sprechen sich 63% der Befragten gegen ein Verbot aus.
Konsum und Nachhaltigkeit müssen nicht Gegensätze sein.
Werbung hat zum Ziel, Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, aber auch auf Alternativen und Ersatzprodukte hinzuweisen. So lancierten erst kürzlich Lidl und WWF zusammen eine Sensibilisierungskampagne mit dem Motto «Nachhaltig macht mehr Freude». Diese soll auf pflanzliche Alternativen, Bioprodukte und Food Waste aufmerksam machen. Ein Werbeverbot schadet dann nicht nur Initiativen wie dieser, sondern widerspricht auch dem öffentlichen Interesse, welches Nachhaltigkeit immer stärker gewichtet.
KS/CS wird sich weiterhin für das Plakat einsetzen.
Plakatwerbung ist ein abwechslungsreiches und diverses Kommunikationsmittel, welches neben dem Grundziel, Informationen zu vermitteln, zahlreiche Zusatzleistungen für die Schweizer Gesellschaft erbringt. Städte ohne Werbung gibt es, soll es und kann es nicht geben. Denn Aussenwerbung ist für Wirtschaft, Politik und Kultur ein unabdingbares Instrument der Kommunikation. So bleiben Werbegelder in der Schweiz und kommen uns allen in einer oder anderen Form zu gute.